

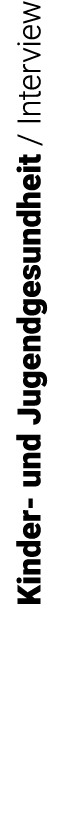

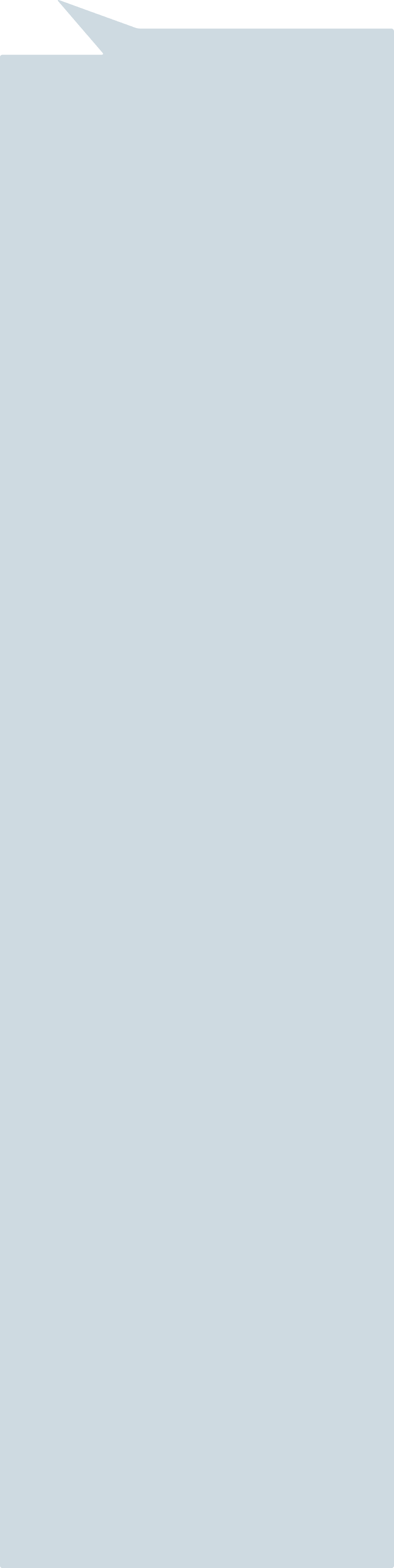
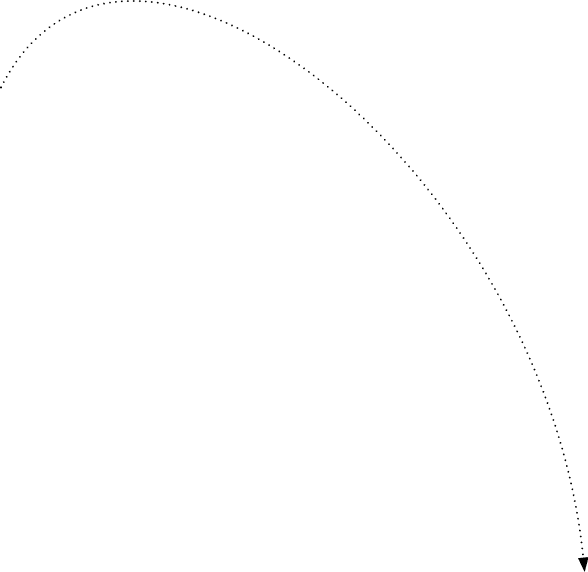


Das kann kein Verein alleine lösen
Interview mit Prof. Dennis Dreiskämper,
TU Dortmund, Studienleiter von „Move for Health“
Welches Ergebnis der Studie hat Sie am meisten überrascht?
Dass wir über alle Altersgruppen hinweg einen so hohen Anteil an Kinder und Jugendlichen mit psychischen Beschwerden und Problemen haben. Es ist bekannt, dass Sporttreiben dort als potenzieller Puffer wirkt. Wir konnten nun aber klar definieren, wer eben nicht von den Vorteilen des Sports profitiert. Das sind Kinder aus armen Familien, aus bildungsfernen Familien, Kinder aus Familien, in denen Berufstätigkeit fehlt, Kinder mit Förderbedarf und Mädchen.
Dem organisierten Sport wird oft vorgehalten ein „Mittelschichtsphänomen“ zu sein …
Ein Viertel der Jugend erreichen wir in sportlicher Hinsicht gar nicht, eben auch nicht der Vereinssport. Die Höhe des Familieneinkommens spielt dabei in der Tat eine große Rolle, übrigens unabhängig davon, ob die Familien einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Jugendliche aus sportfernen Schichten erleben die Barrieren, in einen Verein einzutreten, zudem als zu hoch. Selbst jene, die zum Beispiel aus ästhetischen Gründen sportlich aktiv sein wollen, gehen lieber in ein Fitnessstudio oder machen ganz was anderes. Gerade die Mädchen haben eine hohe Dropoutrate und wünschen sich passendere Angebote.
Ist es nicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, hier etwas zu ändern?
Man kann weder den Sport noch Schulen oder Kitas mit der Aufgabe alleine lassen. Es braucht kommunale Netzwerke, die gezielt auf diese Herausforderungen eingehen, zum Beispiel mit Lotsen für Familien. Das kann kein Verein alleine lösen. Vor allem gilt es, in der Gesellschaft ein Verständnis dafür zu schaffen, wie wertvoll es ist, wenn sich Kinder im Kitaalter oder an der Grundschule sportlich betätigen.
Was könnte der Vereinssport tun?
Niedrigschwellige, differenzierte Sportangebote, die nicht nur das
Leistungsmotiv abdecken, sind hilfreich. Ein praktikabler Zugang zu dieser Zielgruppe sind Kooperationen mit Kitas und Schulen, die OGS.

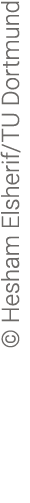
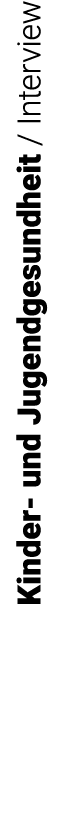

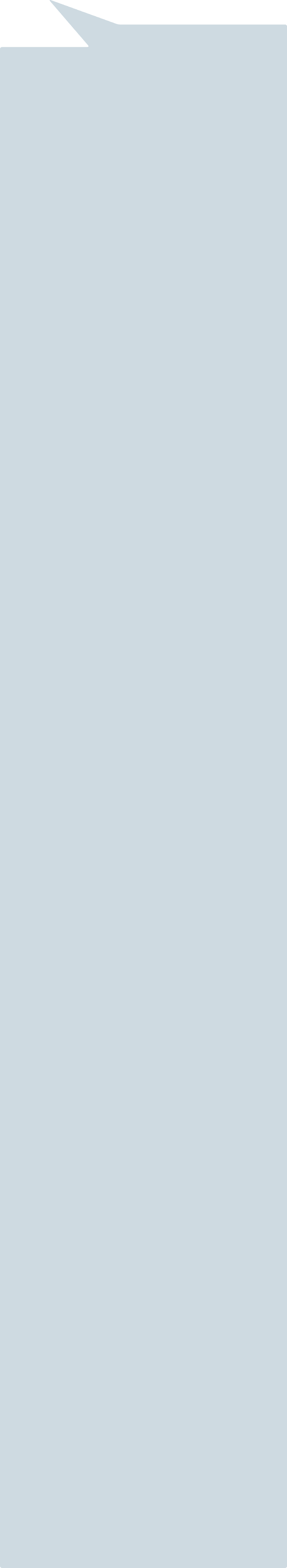

Das kann kein Verein
alleine lösen
Interview mit
Prof. Dennis Dreiskämper,
TU Dortmund, Studienleiter
von „Move for Health“
Welches Ergebnis der Studie hat Sie am meisten überrascht?
Dass wir über alle Altersgruppen hinweg einen so hohen Anteil an Kinder und Jugendlichen mit psychischen Beschwerden und Problemen haben. Es ist bekannt, dass Sporttreiben dort als potenzieller Puffer wirkt. Wir konnten nun aber klar definieren, wer eben nicht von den Vorteilen des Sports profitiert. Das sind Kinder aus armen Familien, aus bildungsfernen Familien, Kinder aus Familien, in denen Berufstätigkeit fehlt, Kinder mit Förderbedarf und Mädchen.
Dem organisierten Sport wird oft vorgehalten ein „Mittelschichtsphänomen“ zu sein …
Ein Viertel der Jugend erreichen wir in sportlicher Hinsicht gar nicht, eben auch nicht der Vereinssport. Die Höhe des Familieneinkommens spielt dabei in der Tat eine große Rolle, übrigens unabhängig davon, ob die Familien einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Jugendliche aus sportfernen Schichten erleben die Barrieren, in einen Verein einzutreten, zudem als zu hoch. Selbst jene, die zum Beispiel aus ästhetischen Gründen sportlich aktiv sein wollen, gehen lieber in ein Fitnessstudio oder machen ganz was anderes. Gerade die Mädchen haben eine hohe Dropoutrate und wünschen sich passendere Angebote.
Ist es nicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, hier etwas zu ändern?
Man kann weder den Sport noch Schulen oder Kitas mit der Aufgabe alleine lassen. Es braucht kommunale Netzwerke, die gezielt auf diese Herausforderungen eingehen, zum Beispiel mit Lotsen für Familien. Das kann kein Verein alleine lösen. Vor allem gilt es, in der Gesellschaft ein Verständnis dafür zu schaffen, wie wertvoll es ist, wenn sich Kinder im Kitaalter oder an der Grundschule sportlich betätigen.
Was könnte der Vereinssport tun?
Niedrigschwellige, differenzierte Sportangebote, die nicht nur das
Leistungsmotiv abdecken, sind hilfreich. Ein praktikabler Zugang zu dieser Zielgruppe sind Kooperationen mit Kitas und Schulen, die OGS.

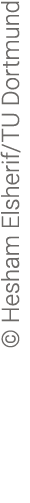
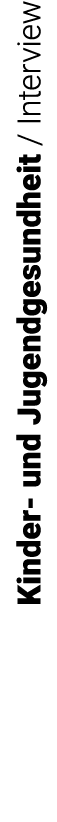

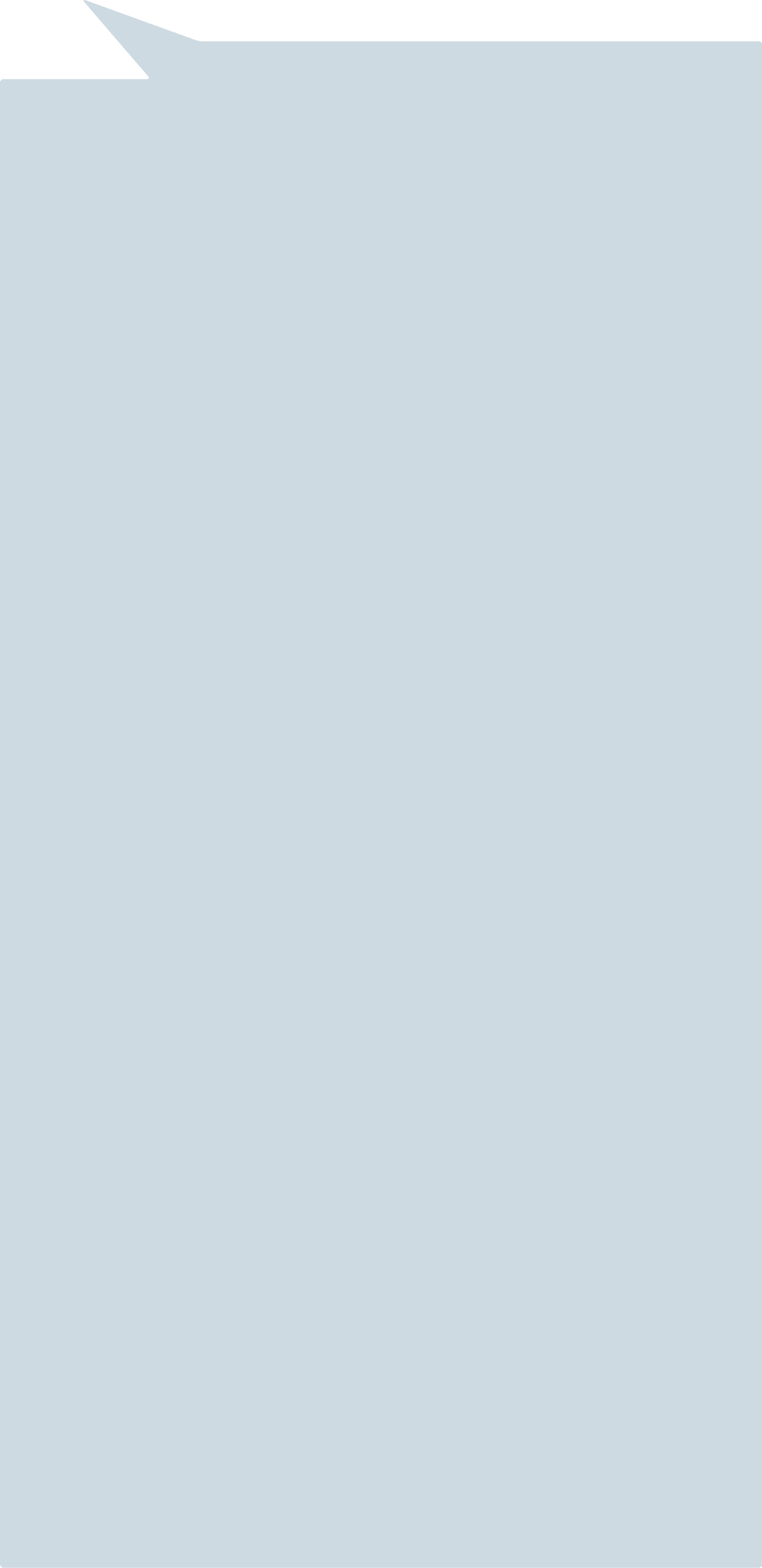


Das kann kein Verein alleine lösen
Interview mit Prof. Dennis Dreiskämper,
TU Dortmund, Studienleiter von „Move for Health“
Welches Ergebnis der Studie hat Sie am meisten überrascht?
Dass wir über alle Altersgruppen hinweg einen so hohen Anteil an Kinder und Jugendlichen mit psychischen Beschwerden und Problemen haben. Es ist bekannt, dass Sporttreiben dort als potenzieller Puffer wirkt. Wir konnten nun aber klar definieren, wer eben nicht von den Vorteilen des Sports profitiert. Das sind Kinder aus armen Familien, aus bildungsfernen Familien, Kinder aus Familien, in denen Berufstätigkeit fehlt, Kinder mit Förderbedarf und Mädchen.
Dem organisierten Sport wird oft vorgehalten ein „Mittelschichtsphänomen“ zu sein …
Ein Viertel der Jugend erreichen wir in sportlicher Hinsicht gar nicht, eben auch nicht der Vereinssport. Die Höhe des Familieneinkommens spielt dabei in der Tat eine große Rolle, übrigens unabhängig davon, ob die Familien einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Jugendliche aus sportfernen Schichten erleben die Barrieren, in einen Verein einzutreten, zudem als zu hoch. Selbst jene, die zum Beispiel aus ästhetischen Gründen sportlich aktiv sein wollen, gehen lieber in ein Fitnessstudio oder machen ganz was anderes. Gerade die Mädchen haben eine hohe Dropoutrate und wünschen sich passendere Angebote.
Ist es nicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, hier etwas zu ändern?
Man kann weder den Sport noch Schulen oder Kitas mit der Aufgabe alleine lassen. Es braucht kommunale Netzwerke, die gezielt auf diese Herausforderungen eingehen, zum Beispiel mit Lotsen für Familien. Das kann kein Verein alleine lösen. Vor allem gilt es, in der Gesellschaft ein Verständnis dafür zu schaffen, wie wertvoll es ist, wenn sich Kinder im Kitaalter oder an der Grundschule sportlich betätigen.
Was könnte der Vereinssport tun?
Niedrigschwellige, differenzierte Sportangebote, die nicht nur das
Leistungsmotiv abdecken, sind hilfreich. Ein praktikabler Zugang zu dieser Zielgruppe sind Kooperationen mit Kitas und Schulen, die OGS.

