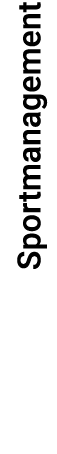Wer in den letzten Monaten seine Lokalzeitung aufschlug, las solche Überschriften: „Essener Ehepaar geschockt: Grundsteuer steigt um 3.225 Prozent“ (WAZ Essen) oder „Kölner soll 3.389 Euro Grundsteuer für eine wertlose Wiese zahlen“ (Kölner Stadt-Anzeiger). Die Neuberechnung der Grundsteuer sorgte landesweit für einigen Frust und zerbissene Tischkanten.
Auslöser für die Reform war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2018. Die Richter*innen erklärten die bis dahin geltenden Einheitswerte – Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer – für verfassungswidrig. Die Lösung: eine Neubewertung aller Grundstücke, basierend auf aktuellen Werten.
Dies geschieht in drei Schritten: Das zuständige Finanzamt ermittelt den Grundsteuerwert, also den Wert der Immobilie, der mit der Grundsteuermesszahl multipliziert wird. Das Ergebnis ist der Grundsteuermessbetrag: Er wird mit Hilfe mehrerer Faktoren berechnet, beispielsweise der Art des Grundstückes, der Bebauung. Zuletzt kommt die zuständige Kommune ins Spiel. Sie legt den Hebesatz fest: eine Prozentzahl (ein Faktor), um die zu entrichtende Grundsteuer zu berechnen. „Diese Neuberechnung kann zu massiven Unterschieden zwischen Gemeinden und der Art der Grundstücke führen“, sagt Rechtsanwalt und VIBSS-Berater Elmar Lumer, „und zu erheblichen Unterschieden zu der alten Grundsteuerberechnung.“
Manche Vereine, die Grundstücke besitzen oder pachten, spüren die Auswirkungen deutlich – besonders solche, die bislang durch alte Einheitswerte nur geringe Beiträge zahlen mussten.
Steuerbefreiung? Ja – aber nur unter Bedingungen
Viele Sportvereine fragen sich: Muss ich künftig wirklich Grundsteuer zahlen? Es kommt drauf an. Zwar besteht nach wie vor die Möglichkeit einer Befreiung, doch diese hängt von zwei zentralen Voraussetzungen ab. Für die subjektive Voraussetzung muss der Eigentümer des Grundstücks eine gemeinnützige Organisation sein. Die objektive Voraussetzung besagt, dass das Grundstück ausschließlich für gemeinnützige Zwecke genutzt werden muss.
Gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht: Die Grundsteuerreform 2025, die für mehr Steuergerechtigkeit sorgen soll, bringt manch saftige Steuererhöhung. Jeder Verein mit Grundbesitz oder in einem Pachtverhältnis kann betroffen sein – besonders trifft es allerdings die Flug- und die Golfvereine. Ist da noch was zu machen?
Rund 10 Hektar groß ist der Flugplatz Neye in Wipperfürth, Grundsteuer wird dafür keine fällig. Gut 10 Kilometer weiter sieht die Sache völlig anders aus: Für den Flugplatz Leye im benachbarten Radevormwald stieg die Grundsteuer mit der Reform von etwa 200 auf deutlich über 6000 Euro.
Wer den Platz hat, zahlt
Wenn also ein Verein Eigentümer eines Grundstücks ist und dieses ausschließlich für sportliche Zwecke nutzt, kann eine Befreiung beantragt werden. Aber betreibt der Verein eine Vereinsgaststätte, so wird dies steuerlich als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb gewertet. Die Folge: Das Grundstück erfüllt nicht die objektive Voraussetzung der ausschließlichen Gemeinnützigkeit. Die Grundsteuer muss gezahlt werden.
Elmar Lumer weist auf die räumliche Aufteilung hin: „Wenn nur ein räumlich abgegrenzter Teil des Grundbesitzes für steuerbegünstigte Zwecke benutzt wird, ist auch nur dieser Teil steuerfrei.“ Ähnlich verhält es sich mit der zeitlichen Aufteilung: „Wird eine Sporthalle zu mehr als 50 Prozent der Zeit durch den gemeinnützigen Verein genutzt, in der restlichen Zeit etwa durch eine selbstständige Trainerin, so greift die Steuerbefreiung für die Sporthalle.“
Noch problematischer ist die Lage bei gepachteten Grundstücken. Mietet ein Verein seinen Sportplatz etwa von einer Kommune oder einem privaten Eigentümer an, liegt die subjektive Voraussetzung nicht beim Verein, sondern beim Eigentümer. Und dieser ist eben nicht steuerbefreit, weil er nicht gemeinnützig ist – sondern nur sein Mieter bzw. Pächter. Der Vermieter reicht die Steuerkosten in der Regel über die Betriebskostenabrechnung an den Verein weiter.
Die Flieger zahlen drauf
Im idyllischen Bergischen Land liegt das Segelfluggelände Radevormwald-Leye. Drei Vereine nutzen den Platz. Für alle drei regelt die Flugplatzgemeinschaft Berg-Mark die Nutzung nach einem Schlüssel. Christoph Heidler, der erste Vorsitzende, seufzt: „Das Gelände ist gepachtet. Die Besitzerin gibt die Grundsteuer eins zu eins an uns weiter, das waren in der Vergangenheit etwa 200 Euro im Jahr. Nach der Neuberechnung liegen wir bei 6.780 Euro. Das können wir nicht tragen“. Das Problem: Zwar ist der Verein gemeinnützig – die Besitzerin ist es aber nicht. Und somit gibt es keine Befreiung von der Grundsteuer. Das belastet die Vereinsfinanzen immens: „Wir müssen die Kosten auf die Flüge umlegen, die somit teurer werden. Und jeder von uns hat Jugendgruppen und möchte den Jugendlichen preiswerten Sport ermöglichen – das wird nun schwierig.“
„Handwerkliche Fehler“
Die Reform habe „handwerkliche Fehler“ in der aktuellen Gesetzeslage offenbart, sagt Christoph Heidler. Wie ungerecht die sich auswirken können, zeigt der Blick nur gut zehn Kilometer weiter, zum Flugplatz Neye im benachbarten Wipperfürth. Dort ist die Verpächterin die Katholische Kirche, deren Liegenschaften weitgehend von der Grundsteuer befreit sind. Wenn sie kirchlich genutzt werden oder wenn der Pächter gemeinnützig ist. Die Konsequenz: Statt wie in Radevormwald fast 6.800 Euro wird in Wipperfürth für einen vergleichbaren Platz gar keine Grundsteuer fällig.
Diese Neuberechnung kann zu massiven Unterschieden zwischen Gemeinden und der Art der Grundstücke führen
Rechtsanwalt Elmar Lumer
Besonders betroffen sind Sportvereine mit einem großen Flächenbedarf. Neben Luftsportvereinen also zum Beispiel auch Golfclubs, Reit- und Fahrvereine oder auch Schützenvereine

Welche Rechte haben Vereine?
„Nur noch wenige“, meint Elmar Lumer. „2024 wurden die Grundsteuerwert- und Messbescheide durch das Finanzamt versandt. Ein Einspruch war innerhalb eines Monats möglich – zum Beispiel bei einer zu hohen Bewertung. 2025 haben die Kommunen die Grundsteuerbescheide verschickt. Auch hier ist ein Widerspruch möglich, etwa bei Rechenfehlern oder einem falschen Hebesatz. Dazu sind allerdings Gutachter nötig.“ Bescheide, die einmal „bestandskräftig“ sind, können nicht mehr regulär angefochten werden. In solchen Fällen bleibt nur noch ein Antrag auf fehlerbeseitigende Fortschreibung – eine Art Korrektur, etwa wenn der Bodenrichtwert nachweislich zu hoch angesetzt wurde.
Weitere Infos:


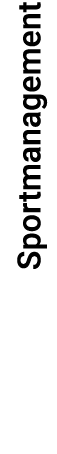






Wer in den letzten Monaten seine Lokalzeitung aufschlug, las solche Überschriften: „Essener Ehepaar geschockt: Grundsteuer steigt um 3.225 Prozent“ (WAZ Essen) oder „Kölner soll 3.389 Euro Grundsteuer für eine wertlose Wiese zahlen“ (Kölner Stadt-Anzeiger). Die Neuberechnung der Grundsteuer sorgte landesweit für einigen Frust und zerbissene Tischkanten.
Auslöser für die Reform war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2018. Die Richter*innen erklärten die bis dahin geltenden Einheitswerte – Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer – für verfassungswidrig. Die Lösung: eine Neubewertung aller Grundstücke, basierend auf aktuellen Werten.
Dies geschieht in drei Schritten: Das zuständige Finanzamt ermittelt den Grundsteuerwert, also den Wert der Immobilie, der mit der Grundsteuermesszahl multipliziert wird. Das Ergebnis ist der Grundsteuermessbetrag: Er wird mit Hilfe mehrerer Faktoren berechnet, beispielsweise der Art des Grundstückes, der Bebauung. Zuletzt kommt die zuständige Kommune ins Spiel. Sie legt den Hebesatz fest: eine Prozentzahl (ein Faktor), um die zu entrichtende Grundsteuer zu berechnen. „Diese Neuberechnung kann zu massiven Unterschieden zwischen Gemeinden und der Art der Grundstücke führen“, sagt Rechtsanwalt und VIBSS-Berater Elmar Lumer, „und zu erheblichen Unterschieden zu der alten Grundsteuerberechnung.“
Manche Vereine, die Grundstücke besitzen oder pachten, spüren die Auswirkungen deutlich – besonders solche, die bislang durch alte Einheitswerte nur geringe Beiträge zahlen mussten.
Steuerbefreiung? Ja – aber nur unter Bedingungen
Viele Sportvereine fragen sich: Muss ich künftig wirklich Grundsteuer zahlen? Es kommt drauf an. Zwar besteht nach wie vor die Möglichkeit einer Befreiung, doch diese hängt von zwei zentralen Voraussetzungen ab. Für die subjektive Voraussetzung muss der Eigentümer des Grundstücks eine gemeinnützige Organisation sein. Die objektive Voraussetzung besagt, dass das Grundstück ausschließlich für gemeinnützige Zwecke genutzt werden muss.
Gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht: Die Grundsteuerreform 2025, die für mehr Steuergerechtigkeit sorgen soll, bringt manch saftige Steuererhöhung. Jeder Verein mit Grundbesitz oder in einem Pachtverhältnis kann betroffen sein – besonders trifft es allerdings die Flug- und die Golfvereine. Ist da noch was zu machen?
Rund 10 Hektar groß ist der Flugplatz Neye in Wipperfürth, Grundsteuer wird dafür keine fällig. Gut 10 Kilometer weiter sieht die Sache völlig anders aus: Für den Flugplatz Leye im benachbarten Radevormwald stieg die Grundsteuer mit der Reform von etwa 200 auf deutlich über 6000 Euro.
Wer den Platz hat, zahlt
Wenn also ein Verein Eigentümer eines Grundstücks ist und dieses ausschließlich für sportliche Zwecke nutzt, kann eine Befreiung beantragt werden. Aber betreibt der Verein eine Vereinsgaststätte, so wird dies steuerlich als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb gewertet. Die Folge: Das Grundstück erfüllt nicht die objektive Voraussetzung der ausschließlichen Gemeinnützigkeit. Die Grundsteuer muss gezahlt werden.
Elmar Lumer weist auf die räumliche Aufteilung hin: „Wenn nur ein räumlich abgegrenzter Teil des Grundbesitzes für steuerbegünstigte Zwecke benutzt wird, ist auch nur dieser Teil steuerfrei.“ Ähnlich verhält es sich mit der zeitlichen Aufteilung: „Wird eine Sporthalle zu mehr als 50 Prozent der Zeit durch den gemeinnützigen Verein genutzt, in der restlichen Zeit etwa durch eine selbstständige Trainerin, so greift die Steuerbefreiung für die Sporthalle.“
Noch problematischer ist die Lage bei gepachteten Grundstücken. Mietet ein Verein seinen Sportplatz etwa von einer Kommune oder einem privaten Eigentümer an, liegt die subjektive Voraussetzung nicht beim Verein, sondern beim Eigentümer. Und dieser ist eben nicht steuerbefreit, weil er nicht gemeinnützig ist – sondern nur sein Mieter bzw. Pächter. Der Vermieter reicht die Steuerkosten in der Regel über die Betriebskostenabrechnung an den Verein weiter.
Die Flieger zahlen drauf
Im idyllischen Bergischen Land liegt das Segelfluggelände Radevormwald-Leye. Drei Vereine nutzen den Platz. Für alle drei regelt die Flugplatzgemeinschaft Berg-Mark die Nutzung nach einem Schlüssel. Christoph Heidler, der erste Vorsitzende, seufzt: „Das Gelände ist gepachtet. Die Besitzerin gibt die Grundsteuer eins zu eins an uns weiter, das waren in der Vergangenheit etwa 200 Euro im Jahr. Nach der Neuberechnung liegen wir bei 6.780 Euro. Das können wir nicht tragen“. Das Problem: Zwar ist der Verein gemeinnützig – die Besitzerin ist es aber nicht. Und somit gibt es keine Befreiung von der Grundsteuer. Das belastet die Vereinsfinanzen immens: „Wir müssen die Kosten auf die Flüge umlegen, die somit teurer werden. Und jeder von uns hat Jugendgruppen und möchte den Jugendlichen preiswerten Sport ermöglichen – das wird nun schwierig.“
„Handwerkliche Fehler“
Die Reform habe „handwerkliche Fehler“ in der aktuellen Gesetzeslage offenbart, sagt Christoph Heidler. Wie ungerecht die sich auswirken können, zeigt der Blick nur gut zehn Kilometer weiter, zum Flugplatz Neye im benachbarten Wipperfürth. Dort ist die Verpächterin die Katholische Kirche, deren Liegenschaften weitgehend von der Grundsteuer befreit sind. Wenn sie kirchlich genutzt werden oder wenn der Pächter gemeinnützig ist. Die Konsequenz: Statt wie in Radevormwald fast 6.800 Euro wird in Wipperfürth für einen vergleichbaren Platz gar keine Grundsteuer fällig.
Diese Neuberechnung kann zu massiven Unterschieden zwischen Gemeinden und der Art der Grundstücke führen
Rechtsanwalt Elmar Lumer

Welche Rechte
haben Vereine?
„Nur noch wenige“, meint Elmar Lumer. „2024 wurden die Grundsteuerwert- und Messbescheide durch das Finanzamt versandt. Ein Einspruch war innerhalb eines Monats möglich – zum Beispiel bei einer zu hohen Bewertung. 2025 haben die Kommunen die Grundsteuerbescheide verschickt. Auch hier ist ein Widerspruch möglich, etwa bei Rechenfehlern oder einem falschen Hebesatz. Dazu sind allerdings Gutachter nötig.“ Bescheide, die einmal „bestandskräftig“ sind, können nicht mehr regulär angefochten werden. In solchen Fällen bleibt nur noch ein Antrag auf fehlerbeseitigende Fortschreibung – eine Art Korrektur, etwa wenn der Bodenrichtwert nachweislich zu hoch angesetzt wurde.
Weitere Infos:




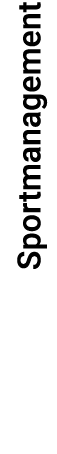








Wer in den letzten Monaten seine Lokalzeitung aufschlug, las solche Überschriften: „Essener Ehepaar geschockt: Grundsteuer steigt um 3.225 Prozent“ (WAZ Essen) oder „Kölner soll 3.389 Euro Grundsteuer für eine wertlose Wiese zahlen“ (Kölner Stadt-Anzeiger). Die Neuberechnung der Grundsteuer sorgte landesweit für einigen Frust und zerbissene Tischkanten.
Auslöser für die Reform war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2018. Die Richter*innen erklärten die bis dahin geltenden Einheitswerte – Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer – für verfassungswidrig. Die Lösung: eine Neubewertung aller Grundstücke, basierend auf aktuellen Werten.
Dies geschieht in drei Schritten: Das zuständige Finanzamt ermittelt den Grundsteuerwert, also den Wert der Immobilie, der mit der Grundsteuermesszahl multipliziert wird. Das Ergebnis ist der Grundsteuermessbetrag: Er wird mit Hilfe mehrerer Faktoren berechnet, beispielsweise der Art des Grundstückes, der Bebauung. Zuletzt kommt die zuständige Kommune ins Spiel. Sie legt den Hebesatz fest: eine Prozentzahl (ein Faktor), um die zu entrichtende Grundsteuer zu berechnen. „Diese Neuberechnung kann zu massiven Unterschieden zwischen Gemeinden und der Art der Grundstücke führen“, sagt Rechtsanwalt und VIBSS-Berater Elmar Lumer, „und zu erheblichen Unterschieden zu der alten Grundsteuerberechnung.“
Manche Vereine, die Grundstücke besitzen oder pachten, spüren die Auswirkungen deutlich – besonders solche, die bislang durch alte Einheitswerte nur geringe Beiträge zahlen mussten.
Steuerbefreiung? Ja – aber nur unter Bedingungen
Viele Sportvereine fragen sich: Muss ich künftig wirklich Grundsteuer zahlen? Es kommt drauf an. Zwar besteht nach wie vor die Möglichkeit einer Befreiung, doch diese hängt von zwei zentralen Voraussetzungen ab. Für die subjektive Voraussetzung muss der Eigentümer des Grundstücks eine gemeinnützige Organisation sein. Die objektive Voraussetzung besagt, dass das Grundstück ausschließlich für gemeinnützige Zwecke genutzt werden muss.
Gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht: Die Grundsteuerreform 2025, die für mehr Steuergerechtigkeit sorgen soll, bringt manch saftige Steuererhöhung. Jeder Verein mit Grundbesitz oder in einem Pachtverhältnis kann betroffen sein – besonders trifft es allerdings die Flug- und die Golfvereine. Ist da noch was zu machen?
Rund 10 Hektar groß ist der Flugplatz Neye in Wipperfürth, Grundsteuer wird dafür keine fällig. Gut 10 Kilometer weiter sieht die Sache völlig anders aus: Für den Flugplatz Leye im benachbarten Radevormwald stieg die Grundsteuer mit der Reform von etwa 200 auf deutlich über 6000 Euro.
Wer den Platz hat, zahlt
Die Flieger zahlen drauf
Im idyllischen Bergischen Land liegt das Segelfluggelände Radevormwald-Leye. Drei Vereine nutzen den Platz. Für alle drei regelt die Flugplatzgemeinschaft Berg-Mark die Nutzung nach einem Schlüssel. Christoph Heidler, der erste Vorsitzende, seufzt: „Das Gelände ist gepachtet. Die Besitzerin gibt die Grundsteuer eins zu eins an uns weiter, das waren in der Vergangenheit etwa 200 Euro im Jahr. Nach der Neuberechnung liegen wir bei 6.780 Euro. Das können wir nicht tragen“. Das Problem: Zwar ist der Verein gemeinnützig – die Besitzerin ist es aber nicht. Und somit gibt es keine Befreiung von der Grundsteuer. Das belastet die Vereinsfinanzen immens: „Wir müssen die Kosten auf die Flüge umlegen, die somit teurer werden. Und jeder von uns hat Jugendgruppen und möchte den Jugendlichen preiswerten Sport ermöglichen – das wird nun schwierig.“
„Handwerkliche Fehler“
Die Reform habe „handwerkliche Fehler“ in der aktuellen Gesetzeslage offenbart, sagt Christoph Heidler. Wie ungerecht die sich auswirken können, zeigt der Blick nur gut zehn Kilometer weiter, zum Flugplatz Neye im benachbarten Wipperfürth. Dort ist die Verpächterin die Katholische Kirche, deren Liegenschaften weitgehend von der Grundsteuer befreit sind. Wenn sie kirchlich genutzt werden oder wenn der Pächter gemeinnützig ist. Die Konsequenz: Statt wie in Radevormwald fast 6.800 Euro wird in Wipperfürth für einen vergleichbaren Platz gar keine Grundsteuer fällig.
Diese Neuberechnung kann zu massiven Unterschieden zwischen Gemeinden und der Art der Grundstücke führen
Rechtsanwalt Elmar Lumer
Besonders betroffen sind Sportvereine mit einem großen Flächenbedarf. Neben Luftsportvereinen also zum Beispiel auch Golfclubs, Reit- und Fahrvereine oder auch Schützenvereine


Wenn also ein Verein Eigentümer eines Grundstücks ist und dieses ausschließlich für sportliche Zwecke nutzt, kann eine Befreiung beantragt werden. Aber betreibt der Verein eine Vereinsgaststätte, so wird dies steuerlich als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb gewertet. Die Folge: Das Grundstück erfüllt nicht die objektive Voraussetzung der ausschließlichen Gemeinnützigkeit. Die Grundsteuer muss gezahlt werden.
Elmar Lumer weist auf die räumliche Aufteilung hin: „Wenn nur ein räumlich abgegrenzter Teil des Grundbesitzes für steuerbegünstigte Zwecke benutzt wird, ist auch nur dieser Teil steuerfrei.“ Ähnlich verhält es sich mit der zeitlichen Aufteilung: „Wird eine Sporthalle zu mehr als 50 Prozent der Zeit durch den gemeinnützigen Verein genutzt, in der restlichen Zeit etwa durch eine selbstständige Trainerin, so greift die Steuerbefreiung für die Sporthalle.“
Noch problematischer ist die Lage bei gepachteten Grundstücken. Mietet ein Verein seinen Sportplatz etwa von einer Kommune oder einem privaten Eigentümer an, liegt die subjektive Voraussetzung nicht beim Verein, sondern beim Eigentümer. Und dieser ist eben nicht steuerbefreit, weil er nicht gemeinnützig ist – sondern nur sein Mieter bzw. Pächter. Der Vermieter reicht die Steuerkosten in der Regel über die Betriebskostenabrechnung an den Verein weiter.
Welche Rechte haben Vereine?
„Nur noch wenige“, meint Elmar Lumer. „2024 wurden die Grundsteuerwert- und Messbescheide durch das Finanzamt versandt. Ein Einspruch war innerhalb eines Monats möglich – zum Beispiel bei einer zu hohen Bewertung. 2025 haben die Kommunen die Grundsteuerbescheide verschickt. Auch hier ist ein Widerspruch möglich, etwa bei Rechenfehlern oder einem falschen Hebesatz. Dazu sind allerdings Gutachter nötig.“ Bescheide, die einmal „bestandskräftig“ sind, können nicht mehr regulär angefochten werden. In solchen Fällen bleibt nur noch ein Antrag auf fehlerbeseitigende Fortschreibung – eine Art Korrektur, etwa wenn der Bodenrichtwert nachweislich zu hoch angesetzt wurde.
Weitere Infos: