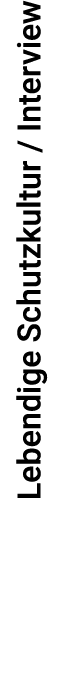Ende des Jahres beenden Sie Ihre Tätigkeit
als unabhängige Beauftragte des LSB zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport. Fällt Ihnen der Abschied schwer?
Einerseits schon, weil ich dem Thema sehr verbunden bin. Aber ich bin ja nicht ganz weg. Ich bringe mich im Bereich queere Akzeptanz und Gleichberechtigung weiterhin für den LSB ein. Zudem bin ich in der gerade konstituierten Kommission der Landesregierung tätig, die Standards zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche etabliert. Und ich bin viel auf Lesereise für mein Buch „Nicht binär leben“, das gerade erschienen ist.
Wenn Sie zurückblicken, was fällt Ihnen
da besonders auf?
Der Umgang mit sexualisierter Gewalt hat sich sehr geändert. In den 1990er-Jahren war es gesamtgesellschaftlich höchst tabuisiert. Schon wer behauptete, es gäbe diese Form der Gewalt, auch im Sport, wurde als „Nestbeschmutzer“ diffamiert. Selbst wohlwollende Menschen glaubten, dass ein Verein Dreck am Stecken haben muss, wenn er sich damit beschäftigt. Erst ab 2010 hat man die Existenz sexualisierter Gewalt allmählich anerkannt, sprach aber noch von Einzelfällen. Ich möchte allerdings betonen, dass der Landessportbund NRW bereits in den 1990ern begonnen hat, Präventions- und Interventionsmaßnahmen aufzusetzen.
Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand?
Es hat sich viel getan in der konkreten Umsetzung. Ungefähr ab 2019 wurde sexualisierte Gewalt gesamtgesellschaftlich, und auch im LSB, als strukturelles Problem anerkannt. Ein ganz wichtiger Schritt war die Einführung des Qualitätsbündnisses, dem inzwischen viele Vereine und Bünde beigetreten sind. In der Breitensport-Studie „SicherImSport“ von 2020/22 gab die überwiegende Zahl der Mitgliedsorganisationen an, dass das Thema wichtig ist. Inzwischen wird der Blick zusätzlich auch auf psychische und andere Formen interpersoneller Gewalt gerichtet. Man kann vieles aufzählen. So gibt es immer mehr Fortbildungsformate über VIBSS. Oder der kommende Schutzkonzeptgenerator und das bereits erschienene Workbook, die Vereine dabei unterstützen, Schutzkonzepte zu entwickeln.
Worauf sind Sie stolz?
Persönlich stolz bin ich darauf, dass das Thema inzwischen eine so breite Akzeptanz erfährt, und auf die Einrichtung der 14 Koordinierungsstellen mit 17 Fachkräften, die sich des Themas annehmen, wenngleich man noch mehr angesichts von 17.300 Sportvereinen in NRW bräuchte.
Bisher einmalig für den Sport in Deutschland ist, dass der Betroffenenrat des LSB sich nicht nur gegründet hat, sondern sich auch immer stärker strukturell einbringt. Darüber bin ich besonders froh, denn es ist uns immer wichtig gewesen, die Sicht der Betroffenen und ihre Erfahrungen einzubeziehen. Auch wurde eine unabhängige externe Anlaufstelle mit zwei Anwältinnen für Betroffene eingerichtet.
Was erhoffen Sie für die Zukunft?
Zunächst die genannten Möglichkeiten auszubauen. Und dass noch mehr Vereine Schutzkonzepte erstellen und mit Leben füllen. Ein dickes Brett für die nächsten Jahre wird es sein, den Safe Sport Code zu diskutieren und zu implementieren, um interpersonelle Gewalt unterhalb der Strafrechtsschwelle sanktionieren zu können. Perspektivisch gilt es den Bereich Aufarbeitung anzustoßen, Standards dafür weiterzuentwickeln und einzuführen. Sinnvoll wäre zudem eine Verzahnung mit dem vom Bund geplanten Zentrum für Safe Sport, dessen Existenz aber noch unklar ist. Es gibt noch sehr viel zu tun, aber insgesamt hat der LSB die richtige Richtung eingeschlagen.
„Der Umgang mit sexualisierter und interpersoneller Gewalt hat
sich sehr geändert“
Interview mit Dr. Birgit Palzkill
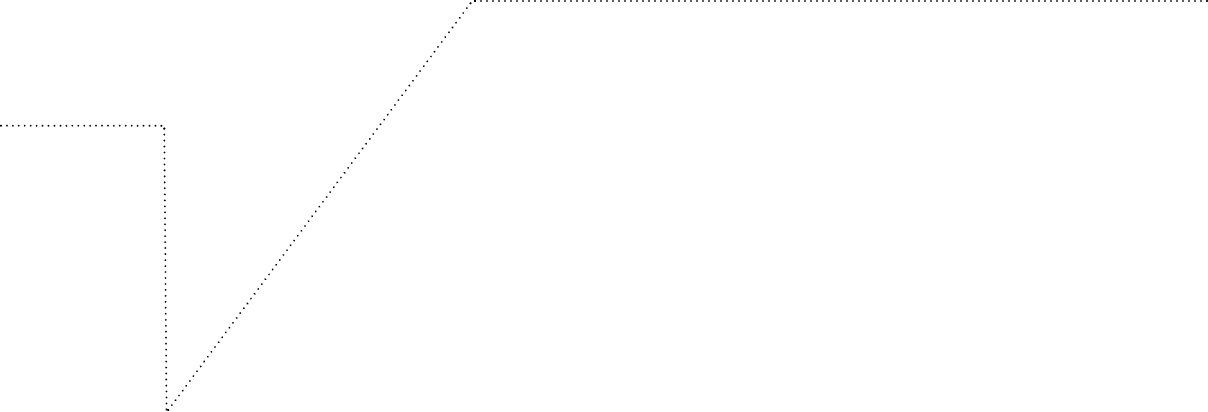
Seit 2017 unabhängige Beauftragte zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport des Landessportbundes NRW. Ihre Studie „Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport“ war 1998 das auslösende Moment dafür, dass sich der organisierte Sport systematisch mit der Prävention sexualisierter Gewalt befasst.

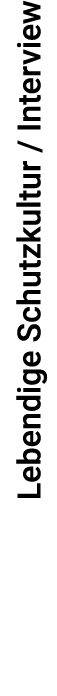

Ende des Jahres beenden Sie Ihre Tätigkeit als unabhängige Beauftragte des LSB zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport. Fällt Ihnen der Abschied schwer?
Einerseits schon, weil ich dem Thema sehr verbunden bin. Aber ich bin ja nicht ganz weg. Ich bringe mich im Bereich queere Akzeptanz und Gleichberechtigung weiterhin für den LSB ein. Zudem bin ich in der gerade konstituierten Kommission der Landesregierung tätig, die Standards zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche etabliert. Und ich bin viel auf Lesereise für mein Buch „Nicht binär leben“, das gerade erschienen ist.
Wenn Sie zurückblicken, was fällt Ihnen da besonders auf?
Der Umgang mit sexualisierter Gewalt hat sich sehr geändert. In den 1990er-Jahren war es gesamtgesellschaftlich höchst tabuisiert. Schon wer behauptete, es gäbe diese Form der Gewalt, auch im Sport, wurde als „Nestbeschmutzer“ diffamiert. Selbst wohlwollende Menschen glaubten, dass ein Verein Dreck am Stecken haben muss, wenn er sich damit beschäftigt. Erst ab 2010 hat man die Existenz sexualisierter Gewalt allmählich anerkannt, sprach aber noch von Einzelfällen. Ich möchte allerdings betonen, dass der Landessportbund NRW bereits in den 1990ern begonnen hat, Präventions- und Interventionsmaßnahmen aufzusetzen.
Wie beurteilen Sie
den aktuellen Stand?
Es hat sich viel getan in der konkreten Umsetzung. Ungefähr ab 2019 wurde sexualisierte Gewalt gesamtgesellschaftlich, und auch im LSB, als strukturelles Problem anerkannt. Ein ganz wichtiger Schritt war die Einführung des Qualitätsbündnisses, dem inzwischen viele Vereine und Bünde beigetreten sind. In der Breitensport-Studie „SicherImSport“ von 2020/22 gab die überwiegende Zahl der Mitgliedsorganisationen an, dass das Thema wichtig ist. Inzwischen wird der Blick zusätzlich auch auf psychische und andere Formen interpersoneller Gewalt gerichtet. Man kann vieles aufzählen. So gibt es immer mehr Fortbildungsformate über VIBSS. Oder der kommende Schutzkonzeptgenerator und das bereits erschienene Workbook, die Vereine dabei unterstützen, Schutzkonzepte zu entwickeln.
Worauf sind Sie stolz?
Persönlich stolz bin ich darauf, dass das Thema inzwischen eine so breite Akzeptanz erfährt, und auf die Einrichtung der 14 Koordinierungsstellen mit 17 Fachkräften, die sich des Themas annehmen, wenngleich man noch mehr angesichts von 17.300 Sportvereinen in NRW bräuchte.
Bisher einmalig für den Sport in Deutschland ist, dass der Betroffenenrat des LSB sich nicht nur gegründet hat, sondern sich auch immer stärker strukturell einbringt. Darüber bin ich besonders froh, denn es ist uns immer wichtig gewesen, die Sicht der Betroffenen und ihre Erfahrungen einzubeziehen. Auch wurde eine unabhängige externe Anlaufstelle mit zwei Anwältinnen für Betroffene eingerichtet.
Was erhoffen Sie
für die Zukunft?
Zunächst die genannten Möglichkeiten auszubauen. Und dass noch mehr Vereine Schutzkonzepte erstellen und mit Leben füllen. Ein dickes Brett für die nächsten Jahre wird es sein, den Safe Sport Code zu diskutieren und zu implementieren, um interpersonelle Gewalt unterhalb der Strafrechtsschwelle sanktionieren zu können. Perspektivisch gilt es den Bereich Aufarbeitung anzustoßen, Standards dafür weiterzuentwickeln und einzuführen. Sinnvoll wäre zudem eine Verzahnung mit dem vom Bund geplanten Zentrum für Safe Sport, dessen Existenz aber noch unklar ist. Es gibt noch sehr viel zu tun, aber insgesamt hat der LSB die richtige Richtung eingeschlagen.
„Der Umgang mit
sexualisierter und
interpersoneller Gewalt hat sich sehr geändert“
Interview mit Dr. Birgit Palzkill
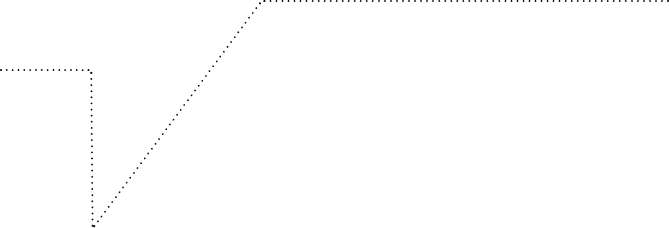
Seit 2017 unabhängige Beauftragte zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport des Landessportbundes NRW. Ihre Studie „Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport“ war 1998 das auslösende Moment dafür, dass sich der organisierte Sport systematisch mit der Prävention sexualisierter Gewalt befasst.

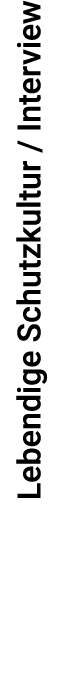

Ende des Jahres beenden Sie Ihre Tätigkeit
als unabhängige Beauftragte des LSB zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport. Fällt Ihnen der Abschied schwer?
Einerseits schon, weil ich dem Thema sehr verbunden bin. Aber ich bin ja nicht ganz weg. Ich bringe mich im Bereich queere Akzeptanz und Gleichberechtigung weiterhin für den LSB ein. Zudem bin ich in der gerade konstituierten Kommission der Landesregierung tätig, die Standards zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche etabliert. Und ich bin viel auf Lesereise für mein Buch „Nicht binär leben“, das gerade erschienen ist.
Wenn Sie zurückblicken, was fällt Ihnen
da besonders auf?
Der Umgang mit sexualisierter Gewalt hat sich sehr geändert. In den 1990er-Jahren war es gesamtgesellschaftlich höchst tabuisiert. Schon wer behauptete, es gäbe diese Form der Gewalt, auch im Sport, wurde als „Nestbeschmutzer“ diffamiert. Selbst wohlwollende Menschen glaubten, dass ein Verein Dreck am Stecken haben muss, wenn er sich damit beschäftigt. Erst ab 2010 hat man die Existenz sexualisierter Gewalt allmählich anerkannt, sprach aber noch von Einzelfällen. Ich möchte allerdings betonen, dass der Landessportbund NRW bereits in den 1990ern begonnen hat, Präventions- und Interventionsmaßnahmen aufzusetzen.
Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand?
Es hat sich viel getan in der konkreten Umsetzung. Ungefähr ab 2019 wurde sexualisierte Gewalt gesamtgesellschaftlich, und auch im LSB, als strukturelles Problem anerkannt. Ein ganz wichtiger Schritt war die Einführung des Qualitätsbündnisses, dem inzwischen viele Vereine und Bünde beigetreten sind. In der Breitensport-Studie „SicherImSport“ von 2020/22 gab die überwiegende Zahl der Mitgliedsorganisationen an, dass das Thema wichtig ist. Inzwischen wird der Blick zusätzlich auch auf psychische und andere Formen interpersoneller Gewalt gerichtet. Man kann vieles aufzählen. So gibt es immer mehr Fortbildungsformate über VIBSS. Oder der kommende Schutzkonzeptgenerator und das bereits erschienene Workbook, die Vereine dabei unterstützen, Schutzkonzepte zu entwickeln.
Worauf sind Sie stolz?
Persönlich stolz bin ich darauf, dass das Thema inzwischen eine so breite Akzeptanz erfährt, und auf die Einrichtung der 14 Koordinierungsstellen mit 17 Fachkräften, die sich des Themas annehmen, wenngleich man noch mehr angesichts von 17.300 Sportvereinen in NRW bräuchte.
Bisher einmalig für den Sport in Deutschland ist, dass der Betroffenenrat des LSB sich nicht nur gegründet hat, sondern sich auch immer stärker strukturell einbringt. Darüber bin ich besonders froh, denn es ist uns immer wichtig gewesen, die Sicht der Betroffenen und ihre Erfahrungen einzubeziehen. Auch wurde eine unabhängige externe Anlaufstelle mit zwei Anwältinnen für Betroffene eingerichtet.
Was erhoffen Sie für die Zukunft?
Zunächst die genannten Möglichkeiten auszubauen. Und dass noch mehr Vereine Schutzkonzepte erstellen und mit Leben füllen. Ein dickes Brett für die nächsten Jahre wird es sein, den Safe Sport Code zu diskutieren und zu implementieren, um interpersonelle Gewalt unterhalb der Strafrechtsschwelle sanktionieren zu können. Perspektivisch gilt es den Bereich Aufarbeitung anzustoßen, Standards dafür weiterzuentwickeln und einzuführen. Sinnvoll wäre zudem eine Verzahnung mit dem vom Bund geplanten Zentrum für Safe Sport, dessen Existenz aber noch unklar ist. Es gibt noch sehr viel zu tun, aber insgesamt hat der LSB die richtige Richtung eingeschlagen.
„Der Umgang mit sexualisierter und interpersoneller Gewalt hat
sich sehr geändert“
Interview mit Dr. Birgit Palzkill
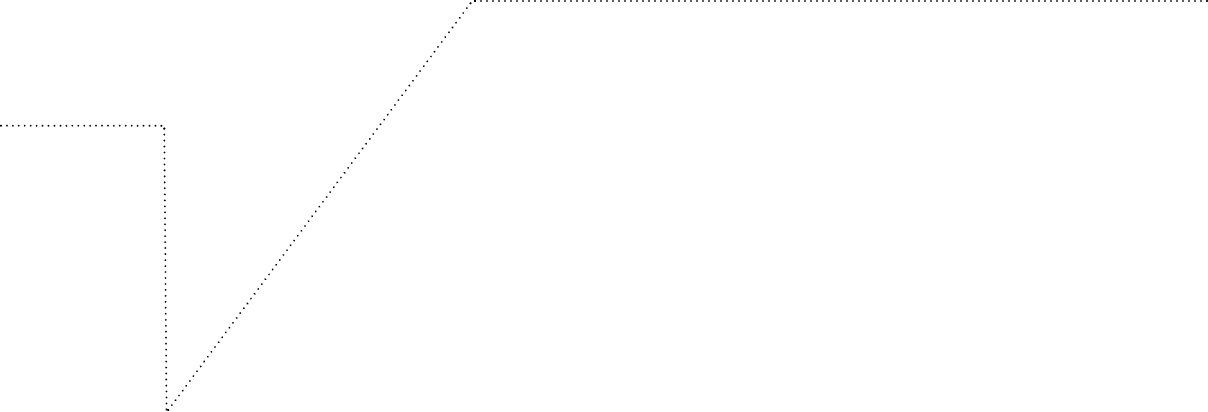
Seit 2017 unabhängige Beauftragte zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport des Landessportbundes NRW. Ihre Studie „Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport“ war 1998 das auslösende Moment dafür, dass sich der organisierte Sport systematisch mit der Prävention sexualisierter Gewalt befasst.